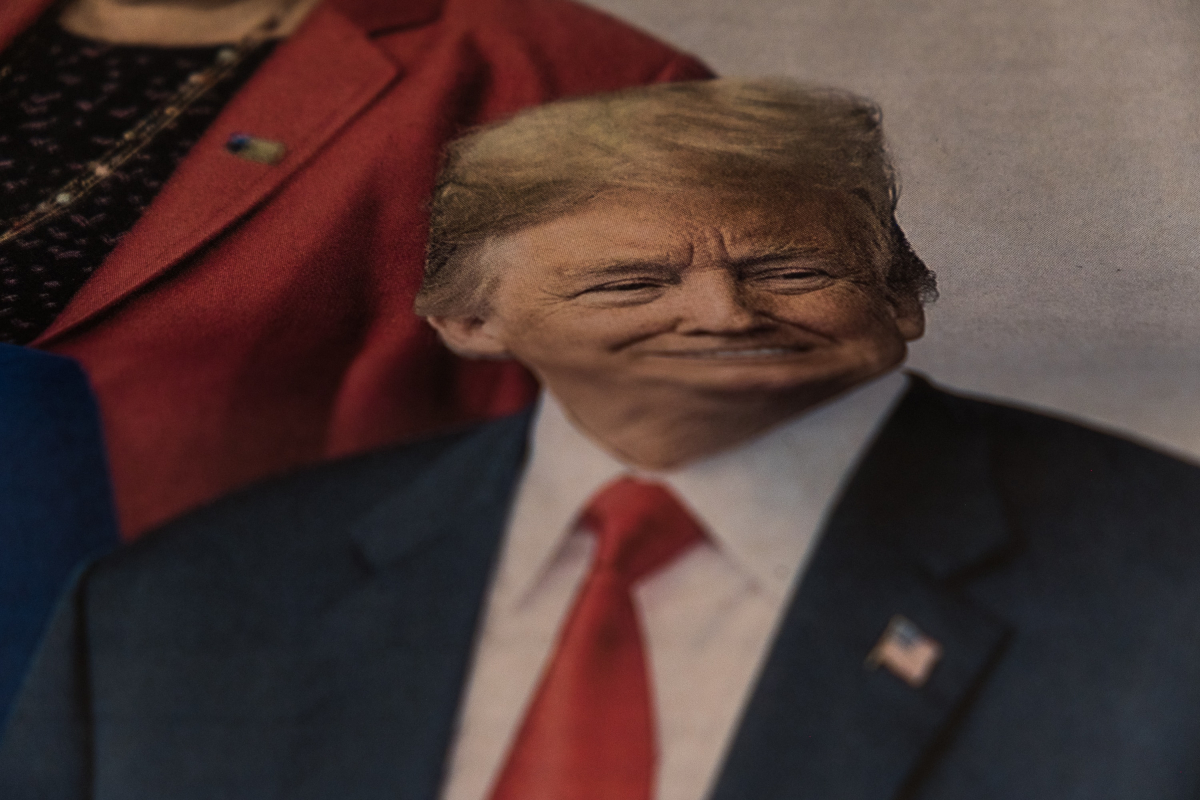Man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem metaphorischen Fenster, wenn man den am 20. Jänner 2017 inaugurierten US-Präsidenten Donald Trump als einen politisch eher unsteten Charakter bezeichnet, der es bestens versteht, mit seinen innen- und außenpolitischen Hacken und Wendungen seine Gegner, seine Freunde, ja, ab und an scheint es fast auch sich selbst zu verwirren. Genauere Prognosen darüber, wie sein weiterer politischer Weg aussehen wird, sind schwierig zu treffen. Eines scheint jedoch relativ gewiss: Er wird in Erinnerung bleiben. Für seine Polarisierung, für seine Rhetorik und vor allem für von ihm geprägte Begriffe wie „fake news“ oder „alternative facts“.
Auch wenn Präsident Trump einer der prominentesten Vertreter einer Epoche ist, der eine grassierende Skepsis gegenüber etablierten Medien und Informationsquellen in absurder Kombination mit einem ausufernden Wachstum pseudowissenschaftlicher Plattformen und Falschmeldungen schon jetzt den Namen postfaktisches Zeitalter eingebracht hat, ist er wohl nicht der Auslöser, sondern viel eher ein Symptom derselben.
Das Monokel durfte Frau Professor Ulrike Tappeiner, Dekanin der Fakultät für Biologie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck sowie Leiterin der Forschungsgruppe „Ecosystem and Landscape Ecology“, zu einem Interview über Schwierigkeiten, Strategien und Möglichkeiten der Universitäten im postfaktischen Zeitalter treffen.
Sehr geehrte Frau Professor Tappeiner, im heutigen akademischen Alltag sind Begriffe wie Good-Scientific-Practice, Scientific Misconduct oder auch Bias allgegenwärtig. Sehen sie auf universitärem Parkett eine Parallele zur steigenden Anzahl von wissenschaftlich nicht fundierten Meldungen in den Massenmedien?
Nein, ich bin überzeugt, dass wir heute so gute wissenschaftliche Kontrollmechanismen wie nie zuvor haben. Sowohl Universitäten als auch Forschungsförderungsorganisationen bekennen sich nicht nur massiv zu den Grundprinzipien solider wissenschaftlicher Arbeit, sondern kommunizieren auch ein klares Procedere für den Fall des Verstoßes. Forschungsanträge und Publikationen in internationalen Fachjournalen werden einem strengen Peer-Review unterzogen. Es ist dies kein neues Instrument, sondern wurde bereits in der griechischen Antike als wissenschaftliche Evaluationsmethode angewandt und ist seit über 300 Jahren ein fester Bestandteil des wissenschaftlichen Publizierens, von den ersten Fachjournalen an. Natürlich gibt es immer wieder auch Probleme, aber die zunehmende Tendenz des offenen Peer-Review, in dem die Reviewerkommentare öffentlich zugänglich sind, trägt viel zur Transparenz und Qualitätssicherung bei. Nach wie vor gilt daher, wie es Peter Lachmann 2002 sagte: „Peer review is not the most efficient mechanism, but it’s the least corruptible.“
Natürlich ist auch die Wissenschaft vor „schwarzen Schafen“, die Daten manipulieren, nicht gefeit. Selbst bei hochkarätigen Journals wie Science oder Nature passiert es, dass solche Studien publiziert werden, und dann später wieder zurückgezogen werden müssen. Allerdings verlangen gute Journals zunehmend, dass auch die Daten, auf denen die Studien basieren, offengelegt werden. Dies bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse nachzurechnen, was insbesondere junge FachkollegInnen auch tun, um dann eventuelles Fehlverhalten aufzuzeigen. Damit ist heute sogar eine weitere Kontrollmöglichkeit gegeben. Wissenschaft öffnet sich heute viel stärker als früher. So antworteten ForscherInnen in einer EU-weiten Studie auf die Frage, welcher Begriff für die Wissenschaft der Zukunft am ehesten gelte, mit großer Mehrheit: „Open Science“, also offene Wissenschaft, in der nicht nur bearbeitete Ergebnisse, sondern auch die Daten offengelegt werden. Experten schlagen daher auch bereits vor, dass neben der klassischen Leistungsbeurteilung eine „Open Science“-Politik gefördert werden muss, in der Transparenz und Genauigkeit wesentliche Ergänzungen der traditionellen Leistungsmessung sein sollten. Mehr Transparenz ist eine klare Waffe gegen falsche Fakten von innen und von außen – gegen Verschwörungstheorien und gegen strategisch geschürte Emotionen.
Wie wichtig ist im heutigen akademischen Alltag das Einhalten der Good-Scientific-Practice-Richtlinien wirklich?
Als Dekanin habe ich mit vielen Verfahren einer akademischen Karriere zu tun: Abschluss des PhD, Habilitationen und Berufungen. In all diesen Fällen ist es jedenfalls in den Naturwissenschaften Standard, externe, unabhängige Gutachten von internationalen Peers einzuholen. Dissertationen werden zudem einer Plagiatskontrolle unterzogen. Ich selbst bin auch vielfach als Gutachterin für internationale Förderprogramme, Forschungsinstitute oder Universitäten tätig. Dies ist zwar zeitintensiv, aber nur wenn alle bereit sind, sich an diesem Prozess zu beteiligen, gelingt eine gute wissenschaftliche Qualitätssicherung. Gerade durch die enorm gestiegene Anzahl von eingereichten Manuskripten bzw. Forschungsanträgen und die damit einhergehende geringe Quote von akzeptierten Publikationen bzw. Förderanträgen, erfolgt eine viel schärfere Kontrolle als vor 20 oder 30 Jahren. Ich bin daher überzeugt, dass das Einhalten der Good-Scientific-Practice-Richtlinien im akademischen Alltag sehr wichtig ist.
Haben die österreichischen Hochschulen in diesem Zusammenhang noch Aufholbedarf?
Nein, alle österreichischen Universitäten haben Richtlinien für die Ethik in Wissenschaft und Forschung und betrachten das Einhalten dieser als ein vorrangiges Anliegen, an vielen gibt es nicht nur eine Ombudsstelle zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis, sondern auch ganz konkret einzuhaltende Vorgaben, wie etwa die Plagiatsprüfung von akademischen Abschlussarbeiten. Auch wird an den Universitäten zunehmend die „Open Science“-Politik gefördert. Allerdings könnten die Anreizsysteme in diese Richtung noch ausgebaut werden.
Sie sind nicht nur erfolgreiche Naturwissenschaftlerin, sondern haben sich im Rahmen Ihrer Ausbildung auch mit philosophischen Fragestellungen befasst. Sir Karl Popper hat mit dem Grundsatz der Falsifikation ein bis heute entscheidendes Prinzip der Erkenntnistheorie eingeführt. Halten Sie unter diesem Gesichtspunkt das Auffinden einer sicheren Wahrheit überhaupt für möglich?
Als Ökologin bin ich in meiner Forschung stets mit der biologischen Streuung konfrontiert, weil selbst beim selben Experiment unterschiedliche Ergebnisse herauskommen, da kein Individuum gleich reagiert wie das andere. Das heißt, Poppers Grundsatz der Falsifikation begleitet mich mein ganzes Forscherleben. Trotzdem zweifle ich nicht daran, dass gewisse „Naturgesetze“ gelten. Es ist sicherlich richtig, dass wissenschaftliche Hypothesen zwar nicht als wahr bewiesen werden können, aber sie können sehr wohl einen bestimmten Grad an Wahrheitsähnlichkeit erreichen, wenn sie sich in einer kritischen Überprüfung und Diskussion besonders bewährt haben. Oder, um das Eingangsstatement Poppers aufzugreifen: Wissenschaft wird viel mehr durch die ständige Suche nach Wahrheit gekennzeichnet, als durch den Besitz von Wahrheit.
Haben Hochschulen Ihrer Meinung nach eine Verpflichtung, einer drohenden Verwilderung von Medien und Wissenskultur auch abseits ihres primären Aufgabengebiets, wie Lehre und Forschung, aktiv entgegen zu wirken?
Ja, ganz eindeutig. Es reicht nicht aus, nur Wissen zu erzeugen und Wissen innerhalb der Hochschule zu vermitteln. WissenschaftlerInnen müssen zudem ihre Auswahlkriterien und Quellen offenlegen, also auch darstellen, wie sie arbeiten und erklären, warum sie sagen, was sie sagen. Die moderne Wissenschaft ist faktenbasiert, aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, was bereits der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann so eindrücklich in seinem Buch „Schnelles Denken, langsames Denken“ vorstellt: Sehr oft lässt sich der Mensch von seinem Unterbewusstsein und seiner Intuition leiten, und führt damit schnell und emotionsgesteuert Entscheidungen herbei, viel seltener aber lässt er sich von langwierigen und oft anstrengenden „vernünftigen“ Überlegungen leiten. Dies hat sehr wohl auch evolutionäre Hintergründe. Für das Überleben zu Beginn der Menschheitsgeschichte war es entscheidend, dass ein Hominide die Hauptprobleme fortwährend, quasi automatisch und vor allem sehr schnell löste und Entscheidungen traf. Dieses, wie es Kahneman nennt, „System 1“ ist viel bequemer und weniger anstrengend, als das für das analytische, logische Denken zuständige „System 2“ und wird daher auch vom modernen Menschen viel häufiger eingesetzt. Gerade die Wissenschaftskommunikation muss sich dessen bewusst werden und daher beide kognitiven Systeme gezielt ansprechen, genauso wie wir im Hochschulunterricht unsere Studierenden damit vertraut machen müssen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Univ.-Prof. Dr. Ulrike Tappeiner ist Dekanin an der Fakultät für Biologie der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und als versierte Wissenschaftlerin unter anderem Leiterin der Forschungsgruppe „Ecosystem and Landscape Ecology“.